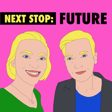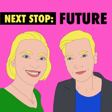Folge 50: Alles wird schlimmer? – Der große Unterschied zwischen Weltbild und Lebensrealität
Wenn man News-Feeds, Talkshows und Kommentarspalten glaubt, sind wir längst kollektiv im Dauer-Alarmmodus. Und trotzdem erleben viele Menschen ihr eigenes Leben als erstaunlich stabil – während „Deutschland“ oder „die Welt“ als zunehmend außer Kontrolle wahrgenommen werden. Genau dieses Paradox nehmen wir uns in dieser Folge vor: der große Unterschied zwischen Weltbild und Lebensrealität.
Als empirischen Anker greifen wir u. a. die R+V-Langzeitstudie „Die Ängste der Deutschen“ auf. Spannend ist vor allem der Angstindex (Durchschnitt über alle abgefragten Sorgen):
- 2025: 37
- 2024: 42
- 2023: 45
- 2022: 42
Heißt: Trotz Omnikrisen-Gefühl sinkt das durchschnittliche individuelle Angstniveau zuletzt deutlich – und 2025 ist laut R+V im Langzeitblick sogar einer der niedrigsten Werte seit Beginn der Reihe.
In der Folge fragen wir deshalb skeptisch nach: Was messen solche Zahlen wirklich – und was erzählen sie nicht?
Wir sprechen außerdem darüber, wie sehr Medienlogiken und Social Media unsere kollektive Wahrnehmung verstärken können (Stichwort: Aufmerksamkeitsökonomie, Zuspitzung, Dauererregung) – und warum das subjektiv schnell „die Welt wird immer schlimmer“ ergibt, selbst wenn die individuelle Realität differenzierter ist.
Und wir drehen den Begriff „Zukunftsangst“ ein Stück weit um: Vielleicht ist es oft weniger Angst vor der Zukunft – und mehr das Gefühl von geringem Handlungsspielraum gegenüber großen Systemthemen. Wenn Distanz groß ist und Einfluss klein wirkt, kippt der Blick schneller ins Dystopische.
Gleichzeitig suchen wir nach dem, was uns im Gespräch wichtig war: Wie bleiben wir handlungsfähig, ohne naiv zu werden?
Welche Rolle spielen Narrative, politische Visionen und ganz pragmatische Routinen, um den „Zukunftsmuskel“ zu trainieren – also wieder mehr Optionen, Alternativen und gestaltbare Zukünfte zu sehen, statt nur den nächsten Alarm.