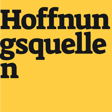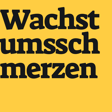Einführung in den Kulturschock
00:00:15
Speaker
Lars, ich freue mich auf eine neue Runde Leute denken.
00:00:20
Speaker
Hi Steffi, ich grüße dich.
00:00:23
Speaker
Ich habe dir ein neues Wort mitgebracht und zwar Kulturschock.
00:00:33
Speaker
Ich glaube, ich selber habe in den letzten Wochen unglaublich viele Kulturschocks erlebt und mir ist aufgefallen, wie wenig bewusst ich mich damit auseinandergesetzt habe und wie sehr er mir auch in der Wissenschaft begegnet.
00:00:49
Speaker
wie sehr ich festgestellt habe, dass ich tatsächlich selber einen Kulturschock erlebe, wenn es darum geht, wer, wie, warum und überhaupt über Gesellschaft und Wirtschaft forscht.
00:01:00
Speaker
Und da würde ich gerne deine Meinung aufzuhören.
00:01:04
Speaker
Was verbindest du denn mit dem Wort Kulturschock?
00:01:06
Speaker
Wo denkst du da als erstes dran?
00:01:11
Speaker
Ad hoc denke ich mir, ich komme irgendwie in soziale Umstände hinein, aus denen ich irgendwie keinen Sinn machen kann.
00:01:23
Speaker
Ja, also im Grunde, wenn wir nochmal an das Normalitätstheater, irgendwie zieht sich diese Folge permanent durch unsere Podcast-Episoden durch, habe ich den Eindruck.
00:01:31
Speaker
Wir beziehen uns zumindest unentwegt drauf.
00:01:33
Speaker
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer Organisation oder in einem anderen Land oder irgendwie auf jeden Fall in sozialen Kontexten, die mir unbekannt sind, unvertraut sind und ich merke da auf einmal, da läuft irgendwie was völlig anders als das, was ich bislang für normal erachtet habe.
Persönliche Erfahrungen mit Kulturschock
00:01:50
Speaker
dann würde ich an der Stelle von einem Kulturschock reden.
00:01:54
Speaker
So würde ich das begreifen.
00:01:55
Speaker
Also wenn die Praxis Kultur, würde ich mal Minimalbestimmung sagen, Kultur ist die Praxis des Sozialen.
00:02:02
Speaker
Und ein Kulturschock ist dann, wenn diese Praxis des Sozialen nicht mit meinen Konstruktionen von Wirklichkeit irgendwie viabel ist, nicht kompatibel ist und da gewisse Diskrepanzen entstehen.
00:02:17
Speaker
So würde ich das greifen.
00:02:18
Speaker
Aber du hast den Begriff mitgebracht.
00:02:19
Speaker
Du hast mit Sicherheit, das ist gerade ja auch schon angedeutet mit Wissenschaft und so, dass du da eigene Erfahrungen hast.
00:02:26
Speaker
Vielleicht magst du davon mal berichten.
00:02:27
Speaker
Was waren das für Situationen, in denen du das empfunden hast und was verbindest du mit dem Begriff?
00:02:32
Speaker
Ich habe tatsächlich vorher sehr viel weniger damit verbunden, als ich es jetzt mittlerweile tue.
00:02:37
Speaker
Vorher war für mich klar, wenn ich in ein anderes Land reise, wo ich Gewohnheiten, Rituale nicht kenne, dann kann ich in so eine Schockstarre geraten, weil ich nicht genau weiß, wie ich mich jetzt so verhalte, dass es dem Menschen mir gegenüber angenehm ist.
00:02:51
Speaker
Also, dass ich nicht ins Fettnäpfchen trete oder...
00:02:54
Speaker
Also dass das Schock nicht ein Moment war, sondern eher so der Moment davor, wo ich gedacht habe, was kann ich jetzt tun, damit ich nicht negativ auffalle, sondern damit ich Teil sein darf, damit ich lernen darf.
00:03:05
Speaker
Und dann kommt man manchmal in so eine Schockstarre und dann entsteht so ein Lernmoment.
00:03:08
Speaker
Das war so ein bisschen mein Erleben.
00:03:10
Speaker
Ich habe für eine Zeit lang ja in Namibia gelebt, wo es ganz, ganz viele unterschiedliche Völker gibt und wo du immer wieder in den Moment kommen durftest, zu sagen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich mich hier jetzt korrekt fühle.
00:03:24
Speaker
oder angemessen allein bei der Begrüßung erhalte, was Respekt ist, wie ich Toleranz zeigen kann, wie ich Offenheit mitbringen kann, wie ich nicht jemanden vor den Kopf stoße, ohne dass ich das möchte.
00:03:38
Speaker
Und dann war immer so ein bisschen vorher die Schockstarre, bis man dann ins Lernen kam und es einfach ausprobieren mochte.
00:03:43
Speaker
Das ist so der Moment, wo ich das erste Mal erlebt habe, ich glaube, ich verbinde mit Kulturschock etwas anderes.
Kritik am Konzept des Kulturschocks
00:03:50
Speaker
Ansonsten finde ich das, wie es üblich beschrieben wird, als sehr abgehoben.
00:03:55
Speaker
Wenn jemand sagt, da habe ich total den Kulturschock erlebt, dann ist es ja so ein bisschen meine Kultur, die ich mitbringe, ist irgendwie hier höher, drüber, anders und die andere führt in mich in einen Schock hinein, was ja eher so ein Negativerleben sonst in den meisten Fällen ist.
00:04:08
Speaker
Diesen Teil des Begriffs mag ich gar nicht so gerne, weil es ja immer bedeutet, ich gehe von dem, mit dem ich komme, aus das Maßgebliche aus.
00:04:16
Speaker
Das entspricht nicht meiner Grundhaltung.
00:04:17
Speaker
Deswegen ist mir dieser Teil von dem Begriff gar nicht so wichtig.
00:04:21
Speaker
Das, was mir wichtig geworden ist, ist Situationen, wo ich glaube, im gleichen Kulturraum zu sein, wo ich vermutet habe, mit den gleichen Praktiken zu arbeiten und so ein Schockmoment kommt und denke, oh, ist man doch ganz anders.
00:04:36
Speaker
wo man das Gefühl der Nähe und der Ähnlichkeit oder der Gemeinsamkeit in den Ritualen und in Denkmustern, in Begrifflichkeiten, in Bildern, wo ich gedacht habe, ich dachte, wir wären uns da näher.
00:04:50
Speaker
Und so ein Schockmoment kommt mit, wow,
00:04:54
Speaker
da sehen Menschen Dinge doch ganz anders.
00:04:57
Speaker
Und wenn es im Wissenschaftssystem ist, wie geht man mit Lernenden um?
00:05:01
Speaker
Oder welchen Stellenwert hat überhaupt das Lernen?
00:05:05
Speaker
Was bedeutet Nachwuchs und was ist ein wertschätzender Umgang mit Nachwuchs?
00:05:10
Speaker
Was ist wann eine gute, qualitativ hochwertige Publikation?
00:05:14
Speaker
Also es ist eher der Moment, wo ich einen Kulturschock erlebe, wo ich dachte, ich dachte, wir wären da auf der gleichen Ebene unterwegs und ich stelle fest, wir schwimmen sehr weit weg auf unserer eigenen Scholle.
00:05:25
Speaker
Kannst du da ein bisschen was mit anfangen?
00:05:28
Speaker
Das ist ja gerade auch in Transformationskontexten so unfassbar wichtig, weil wir einerseits gesellschaftlich ja nach wie vor zumindest weite Teile und vor allen Dingen hierzulande beziehungsweise im industrialisierten globalen Norden,
00:05:46
Speaker
die Vorstellung haben, Transformation ist irgendwie in erster Linie so ein technisches Projekt oder es geht irgendwie um neue Technologien.
00:05:53
Speaker
Aber am Ende ist selbst eine neue Technologie ja immer auch eingebettet und bekommt ihren praktischen Sinn erst in den Momenten, wo sie dann also kulturell auch wirksam
Kulturschock und Transformation
00:06:05
Speaker
Und dann reden wir halt bei Transformationen immer auch über neue Kulturtechniken.
00:06:09
Speaker
Das heißt, wir reden nicht nur über so die große landesspezifische Kultur,
00:06:14
Speaker
Das ist ja häufig ohnehin nicht so wirklich, naja, also
00:06:23
Speaker
Also näher beschreibbar, ausdrückbar, was das Spezifische an der deutschen Kultur jetzt zum Beispiel sein soll.
00:06:32
Speaker
Viel leichter fällt es, wenn man das dann so ein bisschen runterbricht und dann auf unterschiedliche Kulturen im Plural irgendwie auch eingeht und sagt, es gibt zum Beispiel Mobilitätskulturen oder es gibt Ernährungskulturen.
00:06:44
Speaker
Innerhalb von diesen Ernährungskulturen kann man das dann noch weiter aufbrechen und sagen, da gibt es unterschiedliche Kulturen, was die Erzeugung von Nahrungsmitteln anbetrifft oder was die Weiterverarbeitung, was die Zubereitung von Nahrungsmitteln anbetrifft, aber auch was zum Beispiel den Verzehr von Nahrungsmitteln anbetrifft.
00:07:03
Speaker
Da gibt es unterschiedliche Ernährungskulturen.
00:07:06
Speaker
Und auf einmal kann man da schon sehen, okay, wenn wir über Transformation reden, dann müssen wir irgendwie was an diesen Kulturen, an diesen Kulturtechniken, wie wir Nahrungsmittel zubereiten, anbauen, erzeugen, veredeln, vertreiben und dann eben zubereiten und verzehren.
00:07:22
Speaker
Auf der einen Seite über sowas reden, wir reden ja aber auch über Kommunikationskulturen, über Mobilitätskulturen.
00:07:30
Speaker
Das ist dann nur die abstrakte Beschreibung dafür, ob ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto oder mit dem Zug oder sonst wie.
00:07:35
Speaker
Aber das sind ja ganz konkrete Praktiken auch, sind Gewohnheiten, was du gerade schon sagtest.
00:07:40
Speaker
Also greife ich morgens eben nach einem Fahrradschlüssel oder nach einem Autoschlüssel oder muss ich, wenn ich von A nach B will, vorher irgendwo in der App gucken?
00:07:48
Speaker
wann fährt da der nächste Bus oder der nächste Zug oder wie auch immer so.
00:07:52
Speaker
Also diese Kulturen, die stellen ja immer auch ein ganzes Geflecht von unterschiedlichen Gewohnheiten auf der einen Seite, aber ja auch Sprechweisen auf der anderen Seite da.
00:08:04
Speaker
Das war es Ted Schatzky, so diesen Nexus of Doings and Sayings genannt hat.
00:08:08
Speaker
Und wenn wir sagen Transformation, da geht es im Grunde um
00:08:13
Speaker
Darum eben auch diese Kulturen, nicht nur neue Technologien, sondern es geht um anderen Umgang, andere soziale Praxis.
00:08:21
Speaker
Dann müssen wir irgendwie auch an diese kulturelle Dimension heran, müssen wir da ja vordringen.
Reflexivität und Kulturschock nach Heidegger
00:08:27
Speaker
Und das Moment des Schocks ist da ein Moment, der ja unfassbar wichtig ist, um sich die Gestaltbarkeit von Kultur auch vor Augen zu führen.
00:08:37
Speaker
Da sind wir wieder beim Normalitätstheater zu erkennen, dass das auch ganz anders gehen könnte.
00:08:45
Speaker
Ist das denn etwas, was, wer erkennt, das ist das so ein bisschen, womit ich mich dann auch beschäftigt, bin ich diejenige, die aus diesem Schockmoment heraus das erkennt oder gelingt das nur von außen, weil jemand mich im Schockmoment erlebt, also wie komme ich aus diesem Schockmoment in die Reflexion?
00:09:07
Speaker
Das ist eine sehr interessante Frage.
00:09:08
Speaker
Ich denke da automatisch an eine Unterscheidung, die geht zurück auf Martin Heidegger.
00:09:16
Speaker
Da gibt es einen Aufsatz im Journal of Management Studies oder so.
00:09:23
Speaker
Da ging es nämlich genau um diese Frage, so die Verarbeitung von Schockerlebnissen.
00:09:28
Speaker
Also wenn Routinen gewissermaßen so ins Stolpern geraten, also wenn wir nicht mehr so weitermachen können, wie wir das immer schon gemacht haben, so wie kann man das eigentlich auf einer theoretischen Ebene durchsteigen?
00:09:40
Speaker
Und das finde ich eine ausgesprochen spannende Frage, weil
00:09:43
Speaker
Und wenn wir sagen, wir haben da so Kulturen, dann sind die ja auch dadurch gekennzeichnet, dass die schon auch was Stabiles haben.
00:09:53
Speaker
Das ist ja nicht etwas, was irgendwie von heute auf morgen… Immer wieder anziehenden Kern, ne?
00:09:58
Speaker
Irgendwas, was sich da immer wieder dran verknüpft und anknüpft und ja.
00:10:02
Speaker
aber halt in der Tendenz schon eher was, was auch was mit Beharrungskraft auch zu tun hat, was schon halbwegs stabil ist.
00:10:08
Speaker
Es ist gestaltbar, es ist veränderbar, aber es hat schon so eine gewisse Tendenz auch zum Konservatismus.
00:10:14
Speaker
Und dann zu sagen, unser Alltag ist im Grunde genommen geprägt durch so eine ganze Gemengelage von erprobten Praktiken, von Routinen.
00:10:24
Speaker
Und dann ist die Frage, wo genau setzt das Reflexionsmoment eigentlich ein?
00:10:29
Speaker
Und das ist das Spannende eben an diesem Aufsatz.
00:10:32
Speaker
Kann man jetzt in so einem Podcast leider nicht so richtig gut zitieren.
00:10:35
Speaker
Da müsste man sich auch nochmal überlegen, wie kann man da Wissenschaftskommunikation nochmal ein bisschen mit Quellen unterfüttern.
00:10:41
Speaker
Aber was die in diesem Aufsatz machen, ist halt zu zeigen, es gibt unterschiedliches Bewältigungsverhalten.
00:10:48
Speaker
Das heißt Coping Strategies.
00:10:49
Speaker
Also wie genau verhalten wir uns in solchen Situationen?
00:10:53
Speaker
Wie gehen wir damit um?
00:10:54
Speaker
Und die unterscheiden dann zwischen so
00:10:57
Speaker
absorbierenden Bewältigungsverhalten, wo man sagt, okay, das ist so eine kleine Störung in der Routine, da geht die Welt aber nicht von unter, denn in der Regel haben wir Backup-Routinen.
00:11:07
Speaker
Also wenn ich meine Brille irgendwie nicht finde an dem Ort, an dem ich dachte, dass sie da liegt, dann habe ich noch so zwei, drei andere Orte, wo ich weiß, da lege ich meine Brille auch mal ab und dann gehe ich halt da hin.
00:11:17
Speaker
Das heißt, in dem Moment, wo da ein kleines
00:11:21
Speaker
kleiner Schock irgendwie war, irgendwie eine Störung im Ablauf meiner Routine.
00:11:25
Speaker
Ich habe die Brille nicht gefunden, gehe ich halt zu der anderen Stelle und schon ist gut.
00:11:29
Speaker
Und was Sie da beschreiben ist, es gibt dann so einen Moment, wo das aber nicht mehr funktioniert, weil wir keine Backup-Routinen mehr haben.
00:11:37
Speaker
Wo ich dann also anfangen muss, darüber nachzudenken zum Beispiel, was passiert denn eigentlich?
00:11:44
Speaker
Was ist mit dieser Brille passiert?
00:11:46
Speaker
Wo könnte ich sie abgelegt haben?
00:11:47
Speaker
Also wo ich dann erst
00:11:49
Speaker
Also in so eine richtige theoretische Reflexion reingehen und dann fange ich an zu rekonstruieren.
00:11:54
Speaker
Meine Güte, was habe ich den Tag über gemacht?
00:11:55
Speaker
Ich war erst dort und dann dort und dann dort und da hatte ich sie doch noch.
00:11:58
Speaker
Das heißt, sie könnte irgendwie da und da liegen.
00:12:01
Speaker
Und das ist ja aber ein Moment, wo man in Bezug auf diese Kulturtechniken, Ernährung, Mobilität und so weiter, in der Regel ja gar nicht vordringt.
00:12:12
Speaker
Also auf diese tiefe Reflexionsebene, im Alltag zumindest nicht.
00:12:18
Speaker
Ja, mir fällt so ein bisschen zu ein, dieses...
00:12:21
Speaker
take it, leave it or change it und wir sind so schnell bei diesem take it, dann bleibt es halt so, tut halt noch nicht doll genug weh, der Schock ist noch nicht groß genug, um diese Form ganz zu verlassen oder man fühlt sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes kompetent genug, also das Können, Wollen, Dürfen kommt nicht gut genug zusammen, um es dann zu verändern und so bleiben wir in dieser Schockstarre hängen, können zwar uns in allem anderen wieder bewegen, aber dieser Kulturschock, wo wir eigentlich merken, passt eigentlich nicht mehr so, der geht nicht tief genug.
00:12:52
Speaker
Das ist zumindest meine Vermutung auch da, beziehungsweise die, die es direkt betreffen, sind vielleicht schon so verharrt, dass sie es auch gar nicht selber ändern können.
00:13:01
Speaker
Also was möchte ein Kind auf dem Fahrrad machen?
00:13:04
Speaker
Das wird diesen Kulturschock extrem erleben im Straßenverkehr.
00:13:08
Speaker
Und gerade da können wir tagesaktuell anknüpfen, wenn es um die letzte Generation und ähnliche.
00:13:14
Speaker
Also wenn man dann sagt, okay, die, die sind nicht einfach nur Sand im Getriebe, sondern die machen genau das.
00:13:21
Speaker
Die bringen erprobte Praktiken gewissermaßen ins Stolpern.
00:13:26
Speaker
So, das funktioniert dann halt nicht mehr.
00:13:27
Speaker
Dann kann man nicht da langfahren, wo man immer mit völliger Selbstverständlichkeit dachte, ich komme da irgendwie lang.
00:13:34
Speaker
Und ich habe auch keine Backup-Routine in dem Moment.
00:13:37
Speaker
Klar, ich kann, wenn ich das
Aktivismus und Kulturschock
00:13:38
Speaker
vorher sehe, irgendwie eine andere Straße nehmen oder ich kann das Auto beiseite stellen mit dem Bus weiterfahren, weil die Busspur ja in der Regel freigehalten wird.
00:13:45
Speaker
Aber wenn man da erstmal steht und es geht nicht voran und nicht zurück,
00:13:51
Speaker
Dann ist dieser Moment, dieser Moment des Total Breakdowns, beschreiben die Autorinnen das in dem Text, dieser Moment, wo die Praxis erstmalig auf einer tiefen Ebene infrage gestellt werden kann, also wo gewissermaßen Denkbereitschaft, Reflexionsbereitschaft erstmal einsetzt.
00:14:13
Speaker
Und das hat was mit einem Schockmoment zu tun.
00:14:16
Speaker
Heißt ja auch noch nicht automatisch, dass das dann eine tiefe Reflexion einsetzt.
00:14:22
Speaker
Wir erleben ja gerade diesen Hass und dieses Unverständnis und die Kriminalisierung auch, die gerade jetzt im Kontext von der letzten Generation stattfindet, als Ausdruck davon, dass dort eben Kulturschock stattgefunden hat.
00:14:37
Speaker
Dass da jemand nicht wusste, wie weiter geht.
00:14:42
Speaker
Genau, und das ist, glaube ich, das, was ich beschreiben würde mit, es wird in einem Kulturbereich ein Schock erlebt und es wird, um Veränderungen überhaupt noch erreichen zu können, für einen Schockmoment in einem anderen gesorgt.
00:14:57
Speaker
Also die letzte Generation hat ja sehr im Fokus den Aspekt des Klimawandels und in einem Bereich, wo Kulturpraktiken sonst gut funktionieren, setzen sie ja gezielt einen Schockmoment rein.
00:15:09
Speaker
um Aufmerksamkeit zu bekommen, wo sie sagen, da solltet ihr einen Schock erleben und tut es nicht.
00:15:14
Speaker
Da solltet es euch wehtun und es tut euch nicht weh.
00:15:18
Speaker
Merkt doch mal bitte auf.
00:15:20
Speaker
Wacht doch mal bitte auf.
00:15:23
Speaker
Ganz hingestellt, was und wie diese Aktionen richtig sind, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen oder auch gar nicht in den Fokus stellen, sondern das, was mehr
00:15:33
Speaker
da hervortritt, dass dem eigenen Schockerleben keiner Wahrnehmung geschenkt wird und dadurch in einer Übertragung in einem anderen für einen gesorgt wird.
00:15:44
Speaker
Und das kann und mag ein Weg der Transformation sein und ich frage mich, gibt es nicht auch andere und weitere, wo dieser Schockmoment nicht in eine
00:15:57
Speaker
weitere Welle von Schocks enden müssen, sondern wo dieses Schockerleben in einen Lernmoment kommen kann.
00:16:02
Speaker
Eher Schock ein Stocken sein kann, um in die gemeinsame Veränderung zu kommen und nicht ein Schockmoment, eine Konfrontation bewirken muss.
00:16:11
Speaker
Aber da sind wir ja jetzt gerade damit.
00:16:14
Speaker
Ja, in solchen Momenten wird es empirisch, wird es ausgesprochen schwer, die Hoffnung in die eigene Spezies irgendwie nicht zu verlieren, weil historisch, letztmalig waren das ja alles die großen Schockerlebnisse.
00:16:30
Speaker
Also sei es jetzt irgendwelche
00:16:34
Speaker
Supergaus oder schwere Klimakatastrophen, Überschwemmungen, Starkregen, Dürre, bis hin ja auch zu Klimaflucht und solchen Dingen.
00:16:46
Speaker
Also, es war ja nicht vorausschauend, oder?
00:16:51
Speaker
Genau das, was meine Überlegung nur ist, wir wissen ja, dass es immer große, schwere, starke Schockmomente waren.
00:16:58
Speaker
Ja, durchaus auch ein
00:17:01
Speaker
Fahrtabhängigkeiten, um bei der letzten Folge zu antworten, vorab hatten, sodass man sie hätte kommen sehen können.
00:17:08
Speaker
Und dieses Vorbereiten im Moment, damit sie vielleicht gar nicht eintreten, ist ja eigentlich etwas, was wir vom Reisen kennen.
00:17:15
Speaker
Und meine Überlegung war, so ein Stück weit können wir nicht etwas lernen von dem, wie ich mich vorbereite, wenn ich in andere Kulturkreise gehe, wenn ich versuche, mich anzunähern, wenn ich versuche, Verständnis zu entwickeln,
00:17:27
Speaker
um in einen anderen Kulturbereich zu gehen, kann uns dies nicht auch gelingen, wenn wir auf andere Kultursphären schauen.
Vorbereitung auf Kulturschock und gesellschaftliche Transformation
00:17:34
Speaker
Und welche Form der Bildung und der Annäherung und der Auseinandersetzung braucht es dann, um nicht in die Eskalation zu kommen?
00:17:41
Speaker
Also um nicht in eine Schockstarre, wenn ich ein anderes Land, einen anderen Sprachen, einen Ernährungsraum betrete, zu treten, den ich vielleicht im Reisen erlebe.
00:17:51
Speaker
Dort gibt es Reiseführer, dort gibt es Menschen vor Ort, mit denen ich mit austauschen kann.
00:17:56
Speaker
Da kann ich Dinge im Kleinen kennenlernen.
00:17:59
Speaker
Da kann ich mich annähern.
00:18:01
Speaker
Wäre es nicht möglich, diese Erfahrungswerte und diesen Zugang und diese Art zu arbeiten, um nicht in einen Kulturschock zu kommen, könnten wir die nicht auch übertragen auf andere Kulturpraktiken, wo wir wissen, wir sind kurz vor einer nicht einzeln, sondern gesellschaftsweit erlebten Schockstarre.
00:18:18
Speaker
Denn dieses Erleben in einem Landeskulturraum ist ja häufig dieses Leben einer einzelnen Person.
00:18:26
Speaker
Das, was wir jetzt aber erleben, ist ja ein kollektiver Schock.
00:18:32
Speaker
Und ich frage mich immer, was kann man von dem einen lernen, wenn wir da bewusst sensibilisieren können und uns vorbereiten können, wie viel können wir da nicht vielleicht von nehmen, um auf Transformationen zu blicken und zu verändern, um halt nicht in diese kollektiven, vielleicht erst starre und dann gegeneinander wirkenden Moment zu kommen, sondern in das Gemeinsam Gestalten zu kommen.
00:18:57
Speaker
Also ob wir da müssen mehr Kulturarbeit verstehen.
00:19:02
Speaker
Ja, als kulturelle Bildung, der ja in irgendeiner Weise eine Vision, ein Bild, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild, das Bild einer geteilten und gemeinsam gewollten Zukunft vorausgehen müsste.
00:19:17
Speaker
Ja, einen gemeinsamen Kulturkern entwickeln darf.
00:19:20
Speaker
Und die Aneignung von einem solchen gemeinsamen Bild wäre dann das, was ich als Bildung, in dem Fall als kulturelle Bildung verstehen möchte?
00:19:34
Speaker
Und da, glaube ich, ist der große Knackpunkt.
00:19:37
Speaker
Da waren wir in den ersten Folgen, weißt du noch, als wir über Zukunft viel gesprochen haben.
00:19:42
Speaker
Zukunftsmut war ja auch die eine Episode.
00:19:45
Speaker
Und wir Zukunft damals für uns begriffen haben als das, was wir uns heute vorstellen können.
00:19:53
Speaker
Also Zukunft, nicht die zukünftige Gegenwart, das was dann irgendwann tatsächlich mal eintreten wird, das können wir gar nicht wissen, aber das wird man dann irgendwann in der Zukunft, kann man das dann empirisch erfassen.
00:20:09
Speaker
Aber nein, Zukunft erstmal zu verstehen als das, was wir uns heute vorstellen können.
00:20:15
Speaker
Das heißt gewissermaßen als so ein imaginärer Reichtum auch.
00:20:19
Speaker
Und da, glaube ich, sitzt der sprichwörtliche Hase im Pfeffer, weil wir im Moment einfach einen Mangel, beziehungsweise es gibt es nicht.
00:20:30
Speaker
Ich will es mal so krass formulieren.
00:20:33
Speaker
Es gibt es nicht, beziehungsweise ich nehme es nicht wahr, dass es ein gemeinsames kulturelles
00:20:40
Speaker
Bild einer erstrebenswerten Zukunft gibt, einer Gesellschaft, in der wir mit guten Gründen lieber leben wollten.
Historische Reaktionen auf Kulturschock
00:20:47
Speaker
Und weil es das nicht gibt, weil wir nicht dieses gemeinsame Zielfoto gewissermaßen haben, bleibt ja nur noch die Zukunftsvision aus der Vergangenheit übrig.
00:21:01
Speaker
Und dann hängen wir wieder der ganzen Vorstellung von Technikgläubigkeit einerseits ab, andererseits hängen wir dann ja sofort wieder in den Pfadabhängigkeiten, die uns dahin geführt haben, wo wir heute stehen.
00:21:14
Speaker
Also weil wir ja den Pfad gewissermaßen nur wieder ein Stückchen zurücklaufen.
00:21:18
Speaker
Wir drehen uns ja bloß um, laufen den Pfad nochmal zurück, aber können ja nicht dann sagen, okay, dann biegen wir vorher ab.
00:21:24
Speaker
Das hieße ja Zeitreise.
00:21:27
Speaker
Das funktioniert ja nicht.
00:21:28
Speaker
Und da, glaube ich, ist dieses Gewaltpotenzial, was jetzt gerade im Kontext dieser Klebegeschichten der letzten Generation und so wesentlich geworden ist, ne?
00:21:39
Speaker
Wo du wirklich so merkst, was für ein blanker Hass diesen jungen Menschen, die ja häufig nichts anderes wollen, als darauf hinzuweisen, dass wir als demokratisch verfasste Gesellschaft uns mal auf sowas wie 1,5 Grad Paris und so weiter ja mal verständigt hatten.
00:22:00
Speaker
Also die im Grunde genommen sagen, wir wollen diesen Staat nicht zersetzen, nein, wir wollen, dass er im Grunde genommen nur das tut, was er selber mal gesagt hat, dass er gerne tun möchte.
00:22:13
Speaker
Also im Grunde genommen eine Stärkung der Verfassung und nicht eine Kritik oder eine Infragestellung der Verfassung bedeutet.
00:22:22
Speaker
Und dass denen so ein Hass entgegen, ja auch eine Gewalt, wenn Leute da mit dem Auto sie nahezu umfahren, das ist ja auch Gewalt, die da ausgeübt wird.
00:22:33
Speaker
Gewalt, wo man ja dann auch mal fragen könnte, ob nicht im Sinne von Gewaltmonopol des Staates da nicht irgendwie was schief läuft.
00:22:42
Speaker
Und ich glaube, dass diese Gewalt damit zusammenhängt, dass den Leuten halt kein gemeinsames Zukunftsbild da ist und deswegen nur die alten Erzählungen aus dem 20.
Liminale Räume und kulturelle Transformation
00:22:53
Speaker
Jahrhundert bleiben.
00:22:54
Speaker
Aber die Erzählungen des 20.
00:22:56
Speaker
Jahrhunderts, die haben sich auserzählt.
00:22:59
Speaker
Das ist größtenteils Wunschdenken und das wissen wir mittlerweile.
00:23:05
Speaker
Liegt das daran, dass man aus einem Schockmoment auf das zurückgreift, was einem als bekannt ist, egal wie zuverlässig und wie glaubwürdig das überhaupt noch ist?
00:23:17
Speaker
Also dass dieser Rückfall, weil man wie ins Trudeln kommt und zugreift auf das, was da ist und nicht nach vorne geht, liegt das daran?
00:23:24
Speaker
Also müssten wir quasi den Bewegungsmodus aus einem Kulturschock heraus ändern, damit es nicht das Zurückfallen, sondern das bewusste Schritt nach vorne gehen ist?
00:23:34
Speaker
Ich würde nicht sagen, dass das eine Zwangsläufigkeit ist, aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung.
00:23:38
Speaker
Ich denke da spontan an dieses Buch Kollaps von Jared Diamond, der da den Niedergang der Osterinseln beschrieben hat.
00:23:47
Speaker
Also dieses Volk mit diesen großen Statuen, diese großen langgezogenen Gesichter.
00:23:54
Speaker
Das waren ganz ähnlich wie die Sphinx oder auch Pyramiden im alten Ägypten.
00:24:02
Speaker
Da ging es immer um den jeweiligen Clanführer.
00:24:04
Speaker
Und je wichtiger der sich genommen hat, desto größer mussten die ausfallen.
00:24:10
Speaker
Es ist umstritten, was Jared Diamond da an seinen Studien gemacht hat, durchaus, aber methodisch umstritten,
00:24:17
Speaker
weniger umstritten, und das ist eigentlich eine schöne Erzählung, die er da macht, weil es nämlich ein Muster ist, was er in unterschiedlichen Kulturen aufzeigt, ist, dass im Angesicht der Katastrophe diejenige Praxis, die die Katastrophe herbeiführt, noch intensiviert wird.
00:24:34
Speaker
Naja, weil es halt genau das ist, was man da so tut.
00:24:38
Speaker
Er fragt in diesem Buch zum Beispiel, also die haben auf der Osterinsel einen kompletten Kahlschlag gemacht, die haben alle Palmen abgeholzt,
00:24:44
Speaker
Die hatten dann am Ende kein Holz mehr zum Bau von Häusern oder zum Heizen, zum Kochen und so weiter.
00:24:51
Speaker
Einen kompletten Kahlschlag gemacht.
00:24:54
Speaker
Und Jared Diamond fragte in diesem Buch an einer Stelle, was mag wohl dem Typen durch den Kopf gegangen sein?
00:25:00
Speaker
In Kladde formuliert, nicht wörtlich, aber sinngemäß fragt er an einer Stelle in diesem Buch, was mag dem Typen durch den Kopf gegangen sein, der seine Axt an die letzte Palme auf der Osterinsel angesetzt hat?
00:25:16
Speaker
Da steht nur noch eine einzige und da steht ein Typ davor, der hat eine Axt in der Hand.
00:25:20
Speaker
Was mag der dabei gedacht haben?
00:25:22
Speaker
Und ein paar Seiten später beantwortet er diese Frage dann selbst und vermutet wahrscheinlich gar nichts.
00:25:31
Speaker
Der wird gar nichts gedacht haben, weil der genau das getan hat, was man zu dieser Zeit an diesem Ort eben getan hat, wenn man Holz brauchte.
00:25:40
Speaker
Naja, man fällte halt eine verdammte Palme.
00:25:43
Speaker
Weil es das Normalste für diese Leute, ja, das Normalste der Welt gewesen ist.
00:25:49
Speaker
Und das ist natürlich schon auch eine Gefahr, die hat was mit diesen Pfadabhängigkeiten, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben, zu tun.
00:25:56
Speaker
Die liegt aber auch noch deutlich tiefer, ist meine Vermutung.
00:26:03
Speaker
Bei Diamond läuft es ja auch auf so anthropologische, ich will nicht sagen Konstanten, aber schon auf wiederkehrende Muster hinaus.
00:26:15
Speaker
Es gibt rund um Turner und von Renneb, wurden ja diese liminalen Räume beschrieben.
00:26:21
Speaker
Sie haben es ja in den Übergangsrieten beschrieben, insbesondere in Bezug auf Alter, also zwischen Kind und Erwachsenen.
00:26:30
Speaker
Gibt es diesen Moment des Jugendlichseins, wo es eine Übergangsphase gibt, wo du weder in der einen noch in der anderen Welt zu Hause bist und dass das eigentlich der wichtigste Moment ist?
00:26:40
Speaker
weil das, was war, mit dem, was kommen kann, hinterfragt werden kann.
00:26:45
Speaker
Weil sie noch nicht gefangen sind in den neuen Ritualen und Routinen des Erwachsenenseins, aber den anderen auch schon entwachsen sind und sich dort neue bilden können in diesem liminalen Raum, wo ausprobiert werden kann und wo ausprobiert werden darf und wo Grenzen gesteckt und Grenzen erfahren werden dürfen.
00:27:03
Speaker
Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ob es diesen liminalen Raum, der später ja auch in der Beratungsforschung tatsächlich stark aufgegriffen wurde, ob es den mehr aus der Transformationssicht braucht.
00:27:16
Speaker
Weil dieses, Jugendliche erleben ja so etwas wie einen Kulturschock.
00:27:21
Speaker
Sie dürfen noch nicht, was sie wollen und wollen aber auch nicht mehr, was sie noch dürfen und hängen irgendwo dazwischen.
00:27:26
Speaker
Und eigentlich sind sie das gestaltende Moment der Gesellschaft.
00:27:28
Speaker
Und den Raum haben sie bei uns gar nicht.
00:27:32
Speaker
den Zuspruch und die Werterfahrung und Werterschätzung haben sie auch.
00:27:36
Speaker
Und gleichzeitig sind sie die, die ja das, was wir jetzt als Zukunft beschreiben, nicht nur erleben, sondern auch weiter gestalten sollen.
00:27:43
Speaker
Und ich frage mich immer, ob es nicht notwendig wäre,
00:27:52
Speaker
nicht allein nur den jungen Menschen mehr Raum zu geben, das so oder so, davon bin ich sowieso überzeugt, sondern dieses Bewusstsein, was wir dort aus der anthropologischen Forschung rund um die Frage der liminalen Räume kennen, ob das nicht notwendig wäre, zu verstehen, dass wir diesen kollektiven Schockmoment auch so etwas sein können, wie ein liminaler Raum, aus dem heraus wir neu gestalten können.
00:28:16
Speaker
Und dann stellt sich ja immer die Frage, was gilt es denn, Bewertes zu erhalten und was gilt es, Neues zu gestalten, sodass wir in so einen Ambidextriemoment der Beidhändigkeit kommen und
00:28:28
Speaker
dann würde ein Kulturschock eine positive Wertung erfahren, weil ich dann erfahre, okay, hier ist etwas anders, hier passt noch etwas nicht, was braucht es denn dann?
00:28:37
Speaker
Und aus diesem was braucht es denn dann, könnte ich wieder ins Gestalten kommen.
00:28:41
Speaker
Und ich gebe dir absolut recht, das, was wir das letzte Mal besprochen haben, ist so stark in diesem direkten Handeln, stark in dem operativen Moment.
00:28:49
Speaker
Und das, was mir bei Kulturschock so wichtig ist und so aufgefallen ist, geht tatsächlich an die Basis darunter, an diesem Verstehen,
00:28:59
Speaker
Wo entsteht denn abseits jeder Subjektivierung eine kollektive Praxis, die notwendig ist für die Transformation, abseits des Anrufens des oder der Einzelnen?
00:29:11
Speaker
sondern in der gemeinschaftlichen Wende, in dem Erleben eines Kulturschockes nicht nur weg von, sondern hin zu was.
00:29:20
Speaker
Und dann wärst du wieder bei dem Bild, was du vorhin beschrieben hast.
00:29:23
Speaker
Und ich merke bei allem, was ich rund um Kulturschock bisher kannte und ahnte, dass etwas ganz anderes beschreibt, dass es mir in diesem transformativen Kontext wichtig wäre und auch in dem wissenschaftlichen Kontext tatsächlich wichtig wäre.
00:29:36
Speaker
Und zwar der Moment des
00:29:39
Speaker
Wir innehalten es nicht, um in einer Schockstarre zu verharren, nicht um in ein Gegen das, was ich erlebe, zu gestalten, sondern um es zu verstehen und daraus eine neue kulturelle Praxis erst entwickeln zu können.
00:29:52
Speaker
Nicht um eine gegen die andere anzuwenden, sondern um eine neue entstehen lassen zu können.
00:30:00
Speaker
Indem sie nicht gegeneinander ausgespielt werden, meinst du?
Beispiele für transformative Räume
00:30:04
Speaker
Dass man erstmal so ehrlich verstehen lernt, was geht da gerade ab?
00:30:11
Speaker
Wo drückt der Schuh?
00:30:13
Speaker
Diese liminalen Räume sind ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du ausgeführt hast, so eine Art Zwischenraum.
00:30:22
Speaker
Ja, es ist sowas wie ein Übergangsritus.
00:30:24
Speaker
Also bei Turner und von Rennep werden sie noch als Übergangsritus beschrieben, der in bestimmten Volksstämmen bewusst auch gefeiert und in Bezug gestellt wurde zu bestimmten Lebensabschnitten, die ich aber glaube, die wir als Gesellschaft auch erleben und gestalten könnten, bewusst gestalten könnten, bewusst hergestalten könnten.
00:30:50
Speaker
Worauf würde das dann hinauslaufen?
00:30:53
Speaker
Also Übergangsrituale in Bezug auf was?
00:30:58
Speaker
Gar nicht nur Übergangsrituale, sondern auch Übergangsräume.
00:31:03
Speaker
Es ist ja nicht Schalter umlegen und dann sind wir da, wo wir gerne hinwollen und plötzlich ist das Bild da, was entstehen soll, sondern es bedeutet, dass ich Raum, im wahrsten Sinne des Raumes, also auch physischen Raum habe, wo ich ausprobieren kann, wie es anders gehen könnte.
00:31:16
Speaker
Indem ich nicht sofort festgenagelt werde in dem, wo ich hin soll und von dem, wo ich herkomme, sondern indem ich mich von dem, wo in beiden Welten ein Kulturschock besteht, lösen kann und sagen kann, so und jetzt...
00:31:28
Speaker
Probieren wir das aus.
00:31:29
Speaker
Also ein Raum des Ausprobierens und des Verortens.
00:31:34
Speaker
Es ist dafür, glaube ich, wichtig, sowohl ein physischer Raum, aber auch die Loslösung von festen Modellen oder Konzepten, wie ich sie vielleicht in dem einen Kulturraum nutze und in dem anderen nicht, sondern in ein Konzept kreatives Ausprobieren kommen.
00:31:51
Speaker
Aus Neugier, nicht aus Gefahr heraus.
00:31:56
Speaker
Und dass ich quasi diesen Schockmoment vorwegnehmen kann.
00:32:01
Speaker
Also diesen negativ gemeinten Schockmoment.
00:32:03
Speaker
Sondern erlebe, oh, hier ist etwas anderes.
00:32:06
Speaker
Ich brauche jetzt einen Raum, wo ich ausprobieren kann, wie es noch sein könnte.
00:32:09
Speaker
Nicht, wenn ich das eine und das andere zusammenrechne und immer wieder das Gleiche ins Gemisch komme und es sich gegeneinander aufbläht, sondern wo wirklich Andersartiges entstehen darf.
00:32:19
Speaker
Was gar nicht neu sein muss, was auch wieder ein Decken von Alten sein kann.
00:32:24
Speaker
wo Raum entsteht, auszuprobieren, wo diese Kulturirritation noch nicht in einem Schock gegeneinander entsteht, sondern wo ich mir wünschen würde, dass wir sowas wie eine schon bereits Kulturirritation Raum geben könnten, um zu verstehen, wie wir diese Irritation produktiv finden können.
00:32:44
Speaker
Das finde ich auf der abstrakten Ebene total nachvollziehbar und auch wünschenswert.
00:32:50
Speaker
Ich frage mich gerade, wie das konkret aussehen könnte.
00:32:54
Speaker
Wo habe ich ein Beispiel?
00:32:58
Speaker
Übergabe-Rituale in Kindergärten.
00:33:03
Speaker
Die sind sehr fest von Erwachsenen geplant.
00:33:06
Speaker
Es gibt immer wieder diesen Schockmoment vom Kind, jetzt muss ich mich lösen und gehe in die Hand eines anderen Erwachsenen.
00:33:13
Speaker
Wenn du Kinder fragst, würden sie gerne von ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin abgeholt werden.
00:33:18
Speaker
Warum kann nicht ein kleiner tatsächlich Mini-Flur sein, wo nur Kind auf Kind sich begegnet?
00:33:24
Speaker
Warum kann nicht ein Übergabebereich sein, wo Erwachsenen Kinder in diesen Raum geben und erst mal Kind auf Kind trifft und Kinder diesen Ort schon kennen und sich wohlfühlen, ein anderes Kind an die Hand nehmen und es mit dann in diese Welt nehmen?
00:33:39
Speaker
wäre praktisch baulich einfach umzusetzen.
00:33:43
Speaker
Es wäre ein Ort, wo auf Augenhöhe Begegnung stattfinden kann, wo Kinder auch schon in die gemeinsame Verantwortung für und miteinander genommen werden.
00:33:51
Speaker
Und es ist nicht dieses, ein Erwachsener gibt ab und Erwachsene nehmen ab.
00:33:55
Speaker
Oder sie müssen es sogar alleine schaffen.
00:33:58
Speaker
Das wäre ein simples Beispiel, was mir jetzt einfallen würde, wo, einfach weil ich mal Kinder gefragt habe im Kindergarten, wie sie sich das so erleben und sie sagen, ich würde ganz gern von meiner besten Freundin abgeholt werden, dann wäre ich nicht gar nicht traurig.
00:34:11
Speaker
Ich glaube, da kann man das machen.
00:34:14
Speaker
Also Ausprobiergärten sind für mich so ein Beispiel.
00:34:17
Speaker
Wenn ich Menschen nahe bringen soll, dass sie was anderes essen, dann hilft es nicht, wenn ich ihnen das Essen vorsetze, sondern wenn sie ausprobieren dürfen, wie wächst es denn und wie viel Aufwand ist es denn und wie schmeckt es denn, wenn ich es direkt vom Baum oder aus dem Boden esse.
00:34:33
Speaker
dass ich Ernährungstraktiken auch umstelle, indem ich Anbaupraktiken verstehen kann und das große Ganze erfahren kann.
00:34:40
Speaker
Auch das kann ich im Kleinen ausprobieren, indem ich in Bildungsinstitutionen eher den transdisziplären Gedanken folgend auch die Lernenden als ExpertInnen sehe.
00:34:54
Speaker
Und auch von dort etwas mitnehmen kann und dort eine hohe Mitbestimmung ist, welche Themen in welchem Zusammenhang wann wie gelernt werden können.
00:35:00
Speaker
Also dass die Didaktik dort auch gebrochen wird.
00:35:03
Speaker
Das waren jetzt nur so ein paar, die mir ad hoc einfallen.
00:35:06
Speaker
Ich höre da vor allen Dingen so Partizipation raus.
00:35:08
Speaker
Das ist ja auch gerade so in Transformationskontexten so ein wiederkehrender Topos, zu sagen, es geht darum, Betroffene auch zu Beteiligten zu machen.
00:35:17
Speaker
Ja, wobei mir das in diesen Projekten zu schwammig ist.
00:35:20
Speaker
Dann wird einfach gesagt, so die machen jetzt mit.
00:35:24
Speaker
Aber der Raum, wo sie mitmachen sollen, ist kein Stück gestaltet.
00:35:28
Speaker
Und er ist nicht bedacht darauf, welche Form von Gemeinsam denn da stattfinden soll.
00:35:34
Speaker
Sondern er bedeutet Partizipation, man sitzt gemeinsam in dem Raum des Dorfgemeinschaftsdorfs, hinter Tischen, auf Stühlen fest, aufgereiht und vorne spricht einer.
00:35:42
Speaker
Und dann wird man mal gefragt, was man meint.
00:35:44
Speaker
Das ist für mich, reicht nicht weit genug für Partizipation.
00:35:47
Speaker
Partizipation ist dieses gemeinsame ins Tun kommen, gemeinsame Kulturpraktiken nicht sprechend hinterfragen, sondern ausprobierend verändernd.
00:35:59
Speaker
Ja, muss man ja nicht gleich gegeneinander ausspielen.
00:36:01
Speaker
Also ich finde, sich zusammenzusetzen ist auch schon mal ein wichtiger Punkt.
00:36:05
Speaker
Und dann ins Tun zu kommen.
00:36:07
Speaker
Und du hast für mich gefragt, was Partizipation ist.
00:36:11
Speaker
Und für mich ist das ein Austausch, ist etwas, was ja eigentlich in Partizipation vorgeschaltet ist.
00:36:21
Speaker
Nur weil ich mitsprechen kann, aber noch nicht entscheiden oder gestalten kann, ist das für mich noch kein partizipatives Element.
00:36:28
Speaker
nur weil ich Gehör bekomme.
00:36:30
Speaker
Weil das Gehörte wird dann ja immer noch wieder in den Kulturraum dessen, der es aufnimmt, verändert.
00:36:36
Speaker
Deswegen ist für mich dieses reine Gehörtwerden noch keine Partizipation.
00:36:42
Speaker
Weil das dann immer noch in dem Machtraum des Zuhörenden ist, das in seinem eigenen Kulturraum häufig ja auch ganz unbewusst aufzugreifen, verändert, nur weiterzutragen.
00:36:54
Speaker
Deswegen reicht mir das nicht weit genug.
00:36:56
Speaker
Es stellt sich an der Stelle dann immer die Frage, wer gestaltet diese Räume, ne?
00:37:02
Speaker
Wer sollte das tun?
00:37:04
Speaker
Also irgendjemand muss es tun?
00:37:06
Speaker
Ich glaube, Räume dürfen zur Verfügung gestellt werden mit Elementen und dann von denen, die sie in dem Moment nutzen, gestaltet werden.
00:37:15
Speaker
Also eine Flexibilisierung von Räumen, die eher im Sinne von Open Space Formaten, von Zukunftskonferenzen dann in dem Moment, wo über ein Thema gesprochen wird, dem Thema entsprechend ein Raum gestaltet wird, in dem sich dann entweder zusammengesetzt wird oder Material genommen wird oder rausgegangen wird, mit anderen gesprochen wird.
00:37:36
Speaker
Ich glaube, häufig kannst du im Vorfeld gar nicht sagen, welcher Raum genau gebraucht wird.
00:37:43
Speaker
Ja, das kann sich dann erst im Prozess selbst.
00:37:46
Speaker
Also in den ersten Momenten des Prozesses, des Austauschens kann ich verstehen, welchen Raum, welche Materialien, welche Zugänge brauche ich eigentlich.
00:37:54
Speaker
Das heißt, wir brauchen eher so etwas wie ein Baukastensystem von physischen und methodischen Räumen und Menschen, die diese Prozesse begleiten.
00:38:02
Speaker
Und Menschen, die sich gar nicht inhaltlich da reingeben, sondern die diese Räume dann quasi physisch schaffen und methodisch begleiten.
Rollen der Vermittler in der kulturellen Transformation
00:38:11
Speaker
Und zwar in dem Moment, wo erst verstanden wird, was es eigentlich braucht.
00:38:16
Speaker
Und das heißt, der erste für mich Moment des Minimalen der Kulturirritation ist schon festzustellen, okay, so können wir jetzt gar nicht arbeiten, lass uns mal zusammen rausgehen.
00:38:26
Speaker
Oder so funktioniert das gar nicht, lass uns das mal zusammen Worte sammeln oder aufmalen.
00:38:31
Speaker
Aber diese methodische Kompetenz, aus einer Kulturirritation etwas rauszunehmen und die Veränderung zu gehen, das ist eine Fähigkeit,
00:38:40
Speaker
die ich für unglaublich wichtig halte in der Zukunft.
00:38:42
Speaker
Und das bedeutet auch, in dem Moment zu verstehen, welchen Handlungsraum und welchen Austauschraum brauche ich gerade.
00:38:51
Speaker
Fähigkeit, finde ich, ist da ein ganz wichtiges Stichwort.
00:38:53
Speaker
Also das scheint mir jetzt, wenn ich dir so zuhöre, scheint es mir da bei dir viel um so Fragen von Selbstorganisation auch zu gehen?
00:39:06
Speaker
Ich finde bei so etwas moderierte Selbstorganisation wichtig, damit die Selbstorganisation nicht überhand gewinnt und man sich mit dem eigentlichen Thema nicht beschäftigen kann.
00:39:15
Speaker
Also eine begleitete, also im Englischen würde ich immer sagen facilitated Form der Selbstarbeit.
00:39:23
Speaker
Vielleicht gar nicht Organisationen.
00:39:25
Speaker
Mir geht es nicht darum, dass sie sich organisieren, sondern dass die gemeinsam ins Tun kommen.
00:39:30
Speaker
Und das kann halt bedeuten, dass ich, wenn man tatsächlich einfach mal einen physischen Raum nimmt, sowas wie, bei uns heißen immer Remisen, wo die Anhänger drin stehen und so.
00:39:41
Speaker
Wenn ich da die Möglichkeit habe, da stehen Tische, da stehen Stühle, da steht aber auch eine Werkbank, da ist eine Tafel, da sind Stifte zur Verfügung, da gibt es aber auch eine Karte, wo ich weiß, wo die Umgebung ist.
00:39:52
Speaker
Und das Thema ist, wie kann denn in diesem Bereich angefangen werden, in eine Selbstversorgung zu gehen?
00:39:59
Speaker
Das ist ein ganz unterschiedlicher Raum, je nachdem, welche Kulturschockmomente zu diesem Thema oder Irritationen die Menschen, die dann vor Ort sind, erlebt haben, was es dann braucht, um dafür in die kleinsten Schritte der Transformation zu kommen.
00:40:15
Speaker
Und das kann ein Austausch sein.
00:40:17
Speaker
Das kann sein, dass man sagt, wir rufen jemanden an oder schalten jemanden digital zu.
00:40:21
Speaker
Das kann sein, dass man einfach durch den Ort geht und schaut.
00:40:25
Speaker
Mir sind die Räume, die zur Transformation gerade gegeben werden, zu fest.
00:40:31
Speaker
Also es wird ein Schockmoment erlebt und dann werde ich quasi wie in so eine Zwangskiste gesteckt und dadurch entsteht Druck.
00:40:38
Speaker
Und der kann sich nicht lösen, dass daraus etwas entsteht, was ich lernen kann, anders als wenn ich auf Reisen gehe.
00:40:43
Speaker
Da kann ich über den Markt gehen, da kann ich anderes essen, ich kann es ausprobieren, ich kann es riechen, ich kann Menschen hören, die eine andere Sprache sprechen, ich kann die Musik sehen, ich kann sehen, wie sie sich bewegen, ich kann sehen, wie Tagesrhythmus abläuft, ich kann erstmal beobachten und Teil davon sein.
00:40:59
Speaker
Aber dieses beobachtende, teilhabende Moment im Sinne einer, okay, hier ist ein anderer Kulturraum und ich möchte da rein und ich möchte gucken, wie ich da wirksam werden kann, den haben wir ja nicht.
00:41:12
Speaker
Also wir haben ja nicht so viele Reallabore, dass man so etwas alles ausprobieren kann, aber man kann in partizipativen Momenten Miniformen von Reallaboren schaffen, sowohl um so Kulturirritationen überhaupt erst auszulösen, weil manchmal werden die ja leider gar nicht erlebt, weil sie gar nicht bis ins Bewusstsein vordringen, also in dieses bewusste Sein, also nicht nur das Denkende, sondern in das bewusste Erlebende Sein vordringen.
00:41:36
Speaker
und gleichzeitig aber auch die, die es aus unterschiedlichen Perspektiven erleben, in den Austausch zu bringen, um das Gemeinsame daran zu finden.
00:41:48
Speaker
Und das geht für mich über den Partizipationsbegriff, der halt eine Raumkomponente denkt, hinaus als den, den ich häufig in Transformations- und transdisziplinär angelegten Projekten sehe oder erlebe.
00:42:08
Speaker
Müsste ich hinzufügen.
00:42:10
Speaker
Ich glaube auch gar nicht, dass ich das Beste könnte.
00:42:12
Speaker
Also ich möchte mich da gar nicht drüber stellen.
00:42:14
Speaker
Ich formuliere ja jetzt nur ein Vermissen von.
00:42:17
Speaker
Ob es jetzt besser wäre, weiß ich nicht.
00:42:20
Speaker
Aber das ist so etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass es nochmal eine andere Nuance in die Arbeit an und mit kulturellen Praktiken gibt, wenn man den Aspekt des Schocksmomentes sich bewusst macht.
00:42:33
Speaker
Ja, also zunächst mal möchte ich das gerne aus meiner Perspektive korrigieren.
00:42:37
Speaker
Ich denke durchaus, dass du das besser könntest.
00:42:41
Speaker
Einfach schon, weil du sensibilisiert dafür bist, weil du bereits auch einfach die tiefe Überzeugung hast, dass das wichtig ist.
00:42:49
Speaker
Und das macht ja schon mal einen großen Unterschied.
00:42:52
Speaker
Das heißt noch nicht, dass man zwingend in der Lage dazu ist, fähig ist, aber es ist schon mal die halbe Miete, ne?
Kinder als Modell für Transformation
00:43:00
Speaker
Aber dieses in der Lage sein ist noch ein Aspekt, da würde ich gerne mit dir drüber reden.
00:43:04
Speaker
Du sagtest vorhin auch, das sei eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit.
00:43:08
Speaker
Und da werde ich ja immer hellhörig, wenn es um konkrete Befähigungen und Kompetenzen und so geht.
00:43:16
Speaker
weil die ja schnell aufgezählt werden.
00:43:19
Speaker
In den etwas schmaleren Varianten ist dann von Future Skills und so die Rede.
00:43:24
Speaker
In den etwas gediegeneren, etwas theoretisch elaborierteren Diskursen von Verwirklichungschancen und Capabilities und so die Rede.
00:43:32
Speaker
Aber im Grunde genommen geht es ja vielen nur eigentlich um etwas ganz Einfaches, nämlich dass man Menschen in die Lage versetzt, gewisse Dinge zu tun, sie zu befähigen.
00:43:44
Speaker
Und da stelle ich mir immer die Frage, wo soll das denn eigentlich alles herkommen?
00:43:49
Speaker
Wo kommen diese oder wo könnten die herkommen, diese Fähigkeiten?
00:43:54
Speaker
Einen Raum, der gehalten wird, dann auch gemäß den Bedarfen, die in der Gruppe vor Ort gerade da sind, so klar mit Anleitung durch eine Moderatorin oder ob es jetzt Facilitator oder you name it.
00:44:14
Speaker
Aber wie kann man Menschen in die Lage versetzen, das dann auch konkret zu tun?
00:44:19
Speaker
Also wo soll das herkommen?
00:44:20
Speaker
Wenn ich so Richtung Bildungsinstitutionen schaue, Schule schaue, aber auch Hochschulen schaue, dann studiert man dort in der Regel Fächer.
00:44:31
Speaker
Und ist in dem Sinne ja nicht themenzentriert auf einer methodischen Ebene fähig, sowas zu tun.
00:44:39
Speaker
Und in Organisationen, seien sie jetzt erwerbswirtschaftlich oder nicht, Profit, Non-Profit, NGOs, spielt keine Rolle.
00:44:48
Speaker
Das sind ja nun auch nicht unbedingt die Orte, an denen vor allen Dingen die neue Praxis erlernt wird, sondern vor allen Dingen alte reproduziert wird.
00:44:57
Speaker
Das ist ja gewissermaßen der Sündenfall, weshalb wir über Transformation überhaupt reden, weil sich was ändern muss.
00:45:04
Speaker
Also wo kommt das her?
00:45:05
Speaker
Wo kommen die her?
00:45:06
Speaker
Diese Fähigkeiten, einen Raum, der gehalten wird oder der bereitgestellt wird, gemäß der Bedarfe der jeweiligen Gruppe auszufüllen.
00:45:18
Speaker
Ich glaube, wir dürfen da uns sehr nochmal auf Kinder besinnen, weil Kinder können das noch.
00:45:26
Speaker
Also die gehen in den Wald und schaffen sich ihren Spielort mit dem, was sie da gerade an Welt sehen und brauchen.
00:45:33
Speaker
Also die sind da noch sehr, sehr nah in diesem Intuitiven, was braucht es und wie verbinden wir das, was da ist und mit dem wir arbeiten können.
00:45:41
Speaker
Und das ist ja eine bestimmte Form von Haltung.
00:45:44
Speaker
Ich glaube, das, was es zunächst braucht, ist ein Zulassen,
00:45:52
Speaker
dass man sich durchaus auch uneins sein darf, also sich einig zu sein, dass man sich nicht einig ist und dass das total okay ist und auch gut ist und wichtig ist und dass das nicht bedeutet, dass man gegeneinander ist.
00:46:06
Speaker
Also das ist so ein bisschen dieser Unterschied zwischen das ist doof und du bist doof, das ist ein Unterschied und du bist nicht der Unterschied.
00:46:14
Speaker
Also dass dieses abgrenzende Moment in der Haltung, die wir haben, nicht auf uns untereinander zielt, sondern auf den Themen und unsere Perspektiven und dass wir die anfangen wertzuschätzen.
00:46:24
Speaker
Also das ist eine Form von Haltung.
00:46:27
Speaker
Das ist etwas, was ich tagtäglich üben kann.
00:46:30
Speaker
Respekt und Toleranz und Wertschätzung gegenüber dem Anderssein und dem Andersdenkenden, das mir begegnet.
00:46:38
Speaker
das muss ich nicht gut finden.
00:46:39
Speaker
Ich kann es erstmal minimal interessant finden und dem einem eine Form von Gedankenraum gönnen, um zu schauen, ob es meins ist oder nicht, um auch dann zu sagen, danke, nein, danke, das ist gerade nicht meins, und damit aber den Menschen nicht abzulehnen.
00:46:55
Speaker
Ich glaube, das ist etwas, was wir tatsächlich tagtäglich üben können, wie schnell wir wo was in Schubladen stecken.
00:47:03
Speaker
Und auch etwas, wo wir uns tagtäglich aneinander
00:47:09
Speaker
Das hat mit Bildungsinstitutionen gar nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, Teil der Gesellschaft zu sein.
00:47:16
Speaker
Also da sehe ich auch gar nicht die Bildungsinstitutionen oder die Schulen oder die Hochschulen in der Verantwortung, da irgendein Future Skill zu erwerben, sondern da geht es mir darum, wieder auf
00:47:32
Speaker
auf ein würdevolles Miteinander zu kommen.
00:47:34
Speaker
Also es steht ja sogar in unserem Grundrecht, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern auf das wieder uns zurück zu besinnen, in ein würdesvolles Begegnung zu kommen und aus dieser Haltung heraus zu verstehen, was brauchst du gerade, um dann gemeinsam zu schauen, wie dieser Raum aufgegangen ist.
00:47:50
Speaker
Das ist eher etwas, was ich
00:47:52
Speaker
als Haltung bezeichnen würde, in denen heraus sich eine kulturelle Praktik entwickelt, die aber nichts damit zu tun hat, ob sie mir jemand beibringt, sondern die etwas damit zu tun hat, wie wir sie miteinander tagtäglich einüben.
00:48:07
Speaker
Ja, Überhaltungsarbeit haben wir ja auch schon in einer Folge gesprochen.
00:48:14
Speaker
Da sei an dieser Stelle nochmal der Link drauf gerichtet.
00:48:20
Speaker
Also da einfach gerne auch nochmal reinhören.
00:48:23
Speaker
Ich reibe mich so ein bisschen dran.
00:48:24
Speaker
Ich reibe mich dran, weil es klingt immer so einfach.
00:48:27
Speaker
Man muss es sich nur vergegenwärtigen.
00:48:28
Speaker
Und gerade wenn wir über Kultur reden, bin ich total bei dir.
00:48:33
Speaker
Kulturtechniken, da reden wir über Lesen, Schreiben, Pizza backen, Fahrradfahren, all solche Sachen.
00:48:39
Speaker
Klar, das kann man lernen, das haben wir auch gelernt oder einige von uns haben das gelernt.
00:48:44
Speaker
Bitte, danke, guten Morgen und sowas zu sagen.
00:48:46
Speaker
Das sind ja schon fast Schlossgöln mehr, das meine ich gar nicht.
00:48:50
Speaker
Das kann man alles lernen.
00:48:53
Speaker
Das scheint mir auch nicht der springende Punkt zu sein.
00:48:57
Speaker
Aber die Herausforderung, die ich sehe, entsteht an folgender Stelle.
00:49:01
Speaker
Wenn wir über Kulturschock reden, das heißt, wir reden über Kultur, über dieses Normalitätstheater, über das, was mir mit völliger Selbstverständlichkeit unhinterfragbar erst mal erscheint.
00:49:14
Speaker
Dann stecke ich ja in bestimmten Verhältnissen drin.
00:49:18
Speaker
Und das heißt, mit allem, was ich tue, alles, was ich tue, ist ja bedingt durch diese Verhältnisse, die an anderer Stelle ein Transformationserfordernis aufgeworfen haben.
00:49:30
Speaker
Das heißt, wenn ich ein Kulturproblem habe, weil beispielsweise eine kulturelle Praxis die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten nicht nur bedroht, sondern sogar aktiv vernichtet, wenn ich also ein Kulturproblem habe,
00:49:45
Speaker
dann stecke ich ja auch im Versuch der Lösung dieses Problems nach wie vor in der problematischen Praxis drin.
00:49:54
Speaker
Und da braucht es eine so tiefe Reflexionsebene, dass ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt so eine akademische, oder ob wir so gut beraten sind jetzt, aus so einer akademischen Perspektive zu sagen, naja, fangt man an zu reflektieren, kommt da schon irgendwie drauf, geht auch anders, wir können uns jeden Tag daran erinnern,
00:50:16
Speaker
Dieses und jenes kann man anders tun und so weiter und so fort.
00:50:19
Speaker
Aber so läuft ja der Alltag für die allermeisten Menschen in dieser Welt nicht.
Privilegien und kulturelle Transformation
00:50:25
Speaker
Ich glaube aber, dass was jeder von uns, jede von uns im Alltag kann, ist, weniger Fokus auf Antwort geben zu setzen und mehr auf das zu Fragende.
00:50:34
Speaker
Weißt du, wie ich das meine?
00:50:42
Speaker
Ja, mehr Nachfragen.
00:50:45
Speaker
Mehr sich fragen, mehr andere Fragen, überhaupt mehr den Fragen im Moment in den Fokus zu stellen und Fragen einen Wert zu geben.
00:50:55
Speaker
Bei uns, also zumindest in dem Erleben, in den Umfeldern, wie ich mich gehe, haben Antworten einen viel, viel höheren Wert als die Frage.
00:51:03
Speaker
Und ich glaube, da liegt schon die Krux.
00:51:06
Speaker
Es ist viel, viel wichtiger, sich mehr und mehr Fragen zu stellen, um zu verstehen, worauf man überhaupt schauen möchte.
00:51:12
Speaker
Und über die Fragen den Rahmen zu verstehen und den Raum aufzubauen, in dem man überhaupt erst Antworten suchen möchte.
00:51:20
Speaker
Und das ist etwas, was man tagtäglich tun kann.
00:51:22
Speaker
Aufzupassen, wie ist die Balance zwischen Antworten, die ich meine, direkt geben zu müssen und erstmal nochmal eine Frage zu stellen.
00:51:29
Speaker
Ja, und genau an diesem Punkt Fragen stellen können.
00:51:34
Speaker
Können zeigt immer an, da geht es irgendwie um Fragen von Kompetenz auch, von Könnerschaft.
00:51:42
Speaker
weiß ich nicht, ob alle Menschen oder hinreichend viele Menschen in Verhältnissen unterwegs sind, in denen sie unentwegt das, was sie tun, hinterfragen können.
00:51:53
Speaker
Oder ob das jetzt eben so eine akademische Perspektive ist.
00:51:57
Speaker
Wir haben einfach das immense Privileg.
00:51:59
Speaker
Kinder fragen immer, die lebe ich nicht als akademisch.
00:52:03
Speaker
Dann wäre es eine Altersfrage.
00:52:04
Speaker
Das ist richtig, das ist richtig, weil Kinder das aber auch noch nicht in dem Sinne verlernt haben,
00:52:11
Speaker
Sie haben noch nicht gelernt, dass wenn ich frage, die Menschen glauben, ich habe keine Ahnung, bin dumm.
00:52:16
Speaker
Ja, ja, die sind in dem Sinne ja, was du als diesen liminalen Raum beschrieben hast, da findet ja noch irgendwie so eine, ja auch eine Transformation, aber in dem Fall dann halt in eine Richtung, die nicht so gut ist, normativ gesprochen, findet ja statt.
00:52:32
Speaker
Und gerade deswegen können sie das.
00:52:35
Speaker
Und dürfen sie das auch.
00:52:36
Speaker
Und es ist auch sozial, es ist auch nicht verwerflich, wenn sie es tun.
00:52:40
Speaker
Aber wenn du dir jetzt an anderer Stelle dich in Arbeitsrealitäten hineinversetzt von Menschen, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich das immense Privileg, das ich als Wissenschaftler habe,
00:52:59
Speaker
Dass ich mich hier so hinstellen kann und so fröhlich vor mich hin reflektieren kann und alles erstmal in Frage stellen darf und auch noch das Privileg habe, dafür bezahlt zu werden, dass ich alles in Frage stelle und dann sogar noch mir ein Mikro unter die Nase zu klemmen.
00:53:13
Speaker
Und dann habe ich auch noch das Privileg, dass mir Menschen zuhören dabei.
00:53:16
Speaker
An dieser Stelle gehen Grüße raus in die ganze weite Welt, die uns hier gerade vorstellt.
00:53:21
Speaker
beim lauten Denken zuhören, dass wir, glaube ich, aufpassen sollten, dass diese Kulturtechniken, das sind ja auch Kulturtechniken, des Fragens, des Hinterfragens, des Nachfragens, auch die brauchen ja Ermöglichungsbedingungen.
00:53:38
Speaker
Genau, das ist aber das, was ich meine, warum es wichtig ist, das als Transformationsraum zu schaffen.
00:53:43
Speaker
Diese Ermöglichungsbedingungen.
00:53:45
Speaker
diese Ermöglichungsbedingungen, Fragen stellen zu können, ohne dass ein Kulturblick darauf ging, wer fragt, ist blöd?
00:53:53
Speaker
Wer fragt, hat keine Ahnung.
00:53:55
Speaker
Wer fragt, will sich sonst nicht einbringen.
00:53:59
Speaker
Sondern in diesen transformationsbedingten Anstößen zu verstehen und den Fragen eine hohe Wertigkeit zu bringen, als das, was uns orientiert, viel mehr als die Antworten.
00:54:13
Speaker
Aktuell werden Fragen gestellt, um der Antwort willen.
00:54:16
Speaker
Wir brauchen Räume, die Fragen stellen, um der Fragen willen.
00:54:19
Speaker
Und wo jede, jeder eingeladen ist und einen Mehrwert bringt in dem, wie er sie Fragen stellt.
00:54:27
Speaker
Und ich glaube, dass, ja, ich gebe dir recht, wir sind in einer sehr privilegierten Lage.
00:54:32
Speaker
Gleichzeitig habe ich die Hoffnung, dass es etwas ist, was wir gesellschaftweit tragen können, weil wir als Kind von dort alle kommen.
00:54:39
Speaker
Und leider tatsächlich durch unser Bildungssystem davon abgebracht werden.
00:54:43
Speaker
Wir bekommen in der Schule keine guten Noten für schlaue Fragen, die wir stellen, sondern für schlaue Antworten, die wir geben.
00:54:47
Speaker
Auch Fragen, die andere vorformuliert haben in einem bestimmten Raster.
00:54:51
Speaker
Das ist verkehrte Welt für mich, wenn es darum geht zu verstehen,
00:54:56
Speaker
und Perspektiven aufzubrechen.
00:54:58
Speaker
Und deswegen ist mein Wunsch einfach, wenn es um einen Kulturschockerlebnis-Moment ist, dass wir nicht sofort losrennen, um auf Antworten zu suchen, sondern Fragen um der Fragen willen stellen.
00:55:11
Speaker
Und jedem und jeder diesen Raum ermöglichen, dort die eigene Frage zu stellen.
00:55:16
Speaker
Und nicht als Frage, die jemanden oder etwas angreift, sondern eine Frage aus Neugierde.
00:55:25
Speaker
Dieses Wieso, Weshalb, Warum als Wertigkeit zu verstehen, wie man Räume schafft, in denen dann gemeinsam für einen bestimmten Bereich Antworten gesucht werden können.
00:55:38
Speaker
Damit Ja mag es sein und ich finde es immer gut, wenn man auf Privilegien hinweist, dass wir in dieser privilegierten Lage sind, umso mehr ist es dann unsere Aufgabe, dieses Privileg zu teilen und jedem zu ermöglichen.
00:55:53
Speaker
Und dann ist es für mich Aufgabe der Wissenschaft, Aufgabe der Lehrenden, der Bildungsinstitutionen, diesem Auftrag gereicht zu werden, zu sagen, unser Anteil an der Transformation ist es zu ermöglichen, dass Fragen gestellt werden.
Rahmenwerk für Transformation und Schlussfolgerungen
00:56:09
Speaker
Nicht aus einer Mangel- oder Defizitperspektive, sondern also eben der, die wir brauchen, um in neue Kulturpraktiken kommen zu können.
00:56:21
Speaker
Wie du weißt, mag ich Vereinfachungen von Theorie ganz gerne, weil sie dann auch alltagspraktisch schneller wirksam werden können, wenn es um Praktiken geht, kennen können, dürfen, wollen.
00:56:36
Speaker
Das sind die vier Dimensionen, auf die es ankommt, wenn wir die Frage beantworten wollen, warum handeln Menschen so, wie sie handeln, unter welchen Bedingungen würden sie anders handeln, kennen können, dürfen, wollen.
00:56:46
Speaker
Es geht um das Kennen von bestimmten Handlungsoptionen, die irgendwie da sind oder von Entwicklungsmöglichkeiten, also all die Wahrnehmung der Welt, also überhaupt erstmal den Ausschnitt der Welt, den ich wahrnehme als einen,
00:56:58
Speaker
als einen signifikanten wahrnehme.
00:57:00
Speaker
Es hängt ja von meinem Standpunkt ab, auf dem ich stehe, in meiner Biografie, all meinen Erfahrungen, die ich habe.
00:57:05
Speaker
Dementsprechend habe ich ja einen bestimmten Blick auf die Welt.
00:57:08
Speaker
Das ist ganz wichtig.
00:57:09
Speaker
Und beim Können geht es um Fragen dann eben auch von Kompetenz.
00:57:13
Speaker
Und beim Dürfen, nicht nur auf einer juristischen, sondern eben auch auf einer moralischen, auf einer sozialen Ebene, so was ist eigentlich legitimes Handeln.
00:57:22
Speaker
Und am Ende das Wollen, denke ich, ist klar, geht es um Fragen von Motivation und sowas.
00:57:27
Speaker
Und wenn wir all diese vier Dimensionen kennen können, dürfen und wollen in den Blick nehmen, dann können wir auch diese Räume, von denen du da gesprochen hast, diese Bedingungen schaffen.
00:57:37
Speaker
Dann wissen wir nämlich, okay, es geht nicht nur darum, irgendwie ein abstraktes Wissen über die Klimakrise zu haben.
00:57:43
Speaker
So ein Kennen allein reicht nicht.
00:57:44
Speaker
Es geht auch nicht nur darum zu sagen, ja, okay, ich weiß, da gibt es irgendwie andere Formen von Energieversorgung oder Nahrungsmittelversorgung oder
00:57:56
Speaker
Wie wir mit Wohnraum umgehen, die reine Kenntnis darum reicht nicht aus und nur eine Kompetenz zu haben, aber es beispielsweise nicht zu dürfen, aus welchen Gründen auch immer, weil es juristisch vielleicht auch verboten ist.
00:58:11
Speaker
Ich denke jetzt auch an Containern und sowas, also Umgang mit Nahrungsmitteln, was einfach verboten ist.
00:58:17
Speaker
Also auf der juristischen Ebene, aber auch auf der moralischen Ebene.
00:58:20
Speaker
Was ist legitimes Handeln?
00:58:22
Speaker
Wann kriegt man irgendwie einen schrägen Blick von der Nachbarin oder wann werden Augenbrauen hochgezogen?
00:58:28
Speaker
Man denkt so, ich spinne doch irgendwie.
00:58:31
Speaker
Also dass man so all diese Ebenen in den Blick nimmt.
00:58:34
Speaker
Und dann zu sagen, okay, kennen, können, dürfen, wollen.
00:58:37
Speaker
Und demgemäß gestalten wir Räume und wir begreifen es auch als eine akademische Aufgabe, also als eine wissenschaftliche Aufgabe zu sagen, wir könnten diejenigen sein, gerade weil wir diese immensen Privilegien haben, könnten wir diejenigen sein, die diese Räume, von denen du da gesprochen hast, bereitstellen.
00:58:59
Speaker
Und Menschen befähigen,
00:59:02
Speaker
in diesen Räumen, ganz im Sinne von dem, was du da beschrieben hast, zu schauen, welche Bedarfe sind da, welche Betroffenheiten sind da, wer fehlt vielleicht auch noch, wen müssten wir noch mit dazu holen, was brauchen wir jetzt eigentlich, damit es weitergehen kann.
00:59:18
Speaker
Das ist schon fast eine Programmatik.
00:59:24
Speaker
Also mich hat es überzeugt.
00:59:27
Speaker
Du warst etwas abgeneigt dem Wort gegenüber.
00:59:30
Speaker
Ich finde, es ist wieder ein Wort, was mir wichtig geworden ist.
00:59:36
Speaker
Danke des gemeinsamen Lautdenkens dazu.
00:59:39
Speaker
Ja, mit diesen Schockgeschichten, da bin ich dann schnell in dieser Psychologisierung, wenn es so fight, flight, freeze und irgendwie so diese Geschichten geht und dann zu sagen, nee, Moment, das ist doch irgendwie gar nicht das, worum es gehen sollte.
00:59:50
Speaker
Bei Transformationen reden wir doch über Gestaltung und nicht darüber, in irgendwelchen Affekten oder sowas zu handeln, sondern reflektiert und begründet und bestenfalls wissenschaftlich informiert, aber in jedem Fall demokratisch legitimiert und so weiter und so fort.
01:00:07
Speaker
Du, es war mir eine riesengroße Freude mal wieder.
01:00:10
Speaker
Du hast meinen Tag gerettet.
01:00:14
Speaker
Das ist aber etwas ganz Großartiges.
01:00:15
Speaker
Ich hatte mich auch sehr gefreut und ich freue mich schon auf die nächste Folge und auch auf die Diskussionen, die rund um die Folgen mit anderen Menschen entstehen.
01:00:22
Speaker
Deswegen, ihr lieben Menschen da draußen, fühlt euch herzlich eingeladen, gemeinsam auch laut zu denken.
01:00:30
Speaker
Du sag mal, bevor ich jetzt hier gleich den Jingle einspiele, wir haben zwar jetzt, gerade wo wir die Folge aufnehmen, noch 2022, aber wenn die ausgestrahlt wird, haben wir schon 2023, ne?
01:00:40
Speaker
Dann sage ich mal direkt Happy New Year.
01:00:45
Speaker
Bis zur nächsten Folge, Steffi.